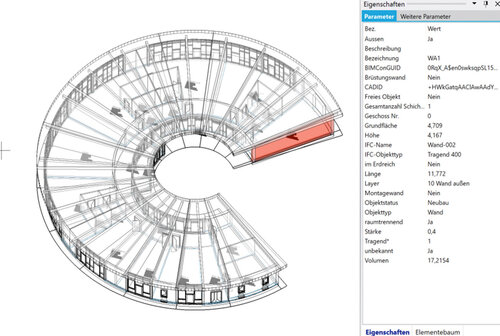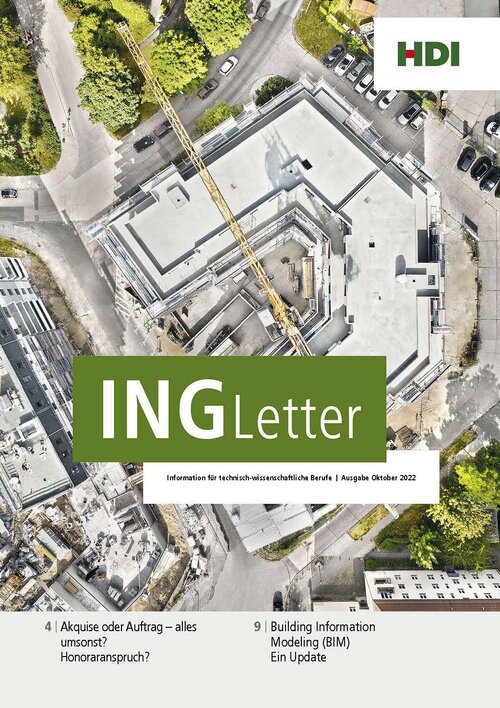Die Situation ist außer Kontrolle: Niemand weiß, was im Inneren des Atomreaktors vor sich geht. Nur eines ist klar - es hat einen ernsten Störfall gegeben! Radioaktivität wird freigesetzt, es besteht die Gefahr der Kernschmelze. Das Betreten des Reaktorgebäudes bedeutet für Rettungsmannschaften den sicheren Tod. Unklar ist, ob sich dort noch Menschen befinden. Aufklärung bringen können jetzt nur noch Roboter.
Glücklicherweise ist dieses Szenario nur ein angenommenes. Das nie in Betrieb gegangene österreichische Atomkraftwerk Zwentendorf liegt an der Donau zwischen Linz und Wien. 1972 wurde mit dem Bau begonnen, aber eine Volksabstimmung vom 5. November 1978 brachte das Aus. Das Kraftwerk ging nie an das Netz; seitdem werden Bauwerk und Gelände gelegentlich für Einsatzübungen zu Katastrophenfällen genutzt. So auch diesen Juli, als hier „EnRicH 2019“, der 2. Europäische Roboter-Hackathon, stattfand. (Hackathon ist eine Wortschöpfung aus der Softwareentwicklung und setzt sich aus „Hack“ und „Marathon“ zusammen.) Das Thema: der Stand der Robotertechnik anhand einer Übung zu einem Ernstfall in einem Atomkraftwerk. Die Veranstalter waren das Amt für Rüstung und Wehrtechnik des österreichischen Heers und das deutsche Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationstechnologie und Ergonomie, das seinen Sitz südlich von Bonn hat.
Wie hoch ist der Grad der Zerstörung?
Bei Katastrophenfällen in Kernkraftwerken, wie zum Beispiel in Tschernobyl und Fukushima, waren es Roboter, die als erste zum Einsatz kamen, um das Leben von Menschen nicht zu gefährden. „In Tschernobyl sollten ferngesteuerte Fahrzeuge für Aufräumarbeiten in Bereichen mit hoher Strahlendosis eingesetzt werden, haben allerdings versagt, da die Technik selbst nicht ausreichend robust gegenüber der Strahlung war. Letztlich wurden hier dann eben doch Menschen eingesetzt“, so Christoph Pistner, Bereichsleiter Nukleartechnik und Anlagensicherheit vom Öko-Institut in Darmstadt. Ähnlich war es in Fukushima: Hier sollten ferngesteuerte Roboter Informationen aus dem Inneren der Sicherheitsbehälter über den Zustand des Reaktorkerns und den Grad der Zerstörung liefern. Auch bei diesem Einsatz scheiterten die ersten Versuche, da die Roboter schon nach sehr kurzer Zeit aufgrund der hohen Strahlung versagten.
Zu den Aufgaben der Maschinen gehört an erster Stelle die Lagefeststellung, wie Brigadier Michael Janisch, Leiter des Amts für Rüstung und Wehrtechnik, in einem Einführungsvortrag deutlich macht: „Was ist los? Was ist mit dem Kühlwasserkreislauf? Wir brauchen Informationen!“, so der Brigadier.
Dazu gehört die Orientierung der Roboter im Bauwerk und Gelände und dies unter erschwerten Bedingungen wie Dunkelheit oder radioaktiver Strahlung, die die Funktion von elektronischen Bauteilen oder der Videokameras beeinträchtigen. Hinzu kommen Kommunikationsprobleme der Roboter mit den Steuerungsmannschaften, da die dicken Betonwände des Reaktorgebäudes kaum Funkwellen durchlassen. Weiter müssen bauliche Hindernisse wie Treppen überwunden werden. Und schließlich geht es um das Eingreifen der Roboter, etwa bei der Bergung von Verletzten oder bei dem Schließen von Kühlwasserventilen.
Was geht heute schon?
Ziel der Übung in Zwentendorf ist es, den Stand der Robotertechnik zu testen. Denn, wie Brigadier Janisch weiter ausführt, „Kernkraft ist ein Faktum in Europa“ und „alle Probleme können uns treffen, wir müssen vorbereitet sein.“ Deshalb müsse man herausfinden, „was heute schon geht“. Seine Erwartung: Bis 2022 sollen Roboter für den Einsatz in Kernkraftwerken beschaffungsreif sein. Frank Schneider, stellvertretender Leiter der Abteilung „Kognitive Mobile Systeme“ am Fraunhofer-Institut, ergänzt: „Wir wollen einen umfassenden Überblick über ihren aktuellen Leistungsstand erhalten. Die ganzen Tests sind streng auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet, um danach die Verbesserung der Roboter zu fördern.“ Fünf Tage dauert der Hackathon.
Es sind elf internationale Teams, die in Zwentendorf mit ihren Robotern an den Start gehen. Die Teilnehmer kommen aus ganz Europa, etwa aus Deutschland, Österreich, England, Ungarn oder Polen. „Rescube Robotic“ nennt sich die Ingenieursgruppe aus Budapest, aus Deutschland sind das Karlsruher Institut für Technologie mit Roboter „GammaBot“ (auf Rädern), die TU Darmstadt, das Fraunhofer Institut sowie die Firma Telerob gekommen.
Aus Österreich sind das Technikum Wien und die Uni Graz vertreten. Die Roboter sollen drei Aufgaben erfüllen: Da ist zum einen das Kartieren des Geländes, um vom Katastrophenort eine möglichst genaue Karte zu erstellen.
In einer zweiten Aufgabe geht es um das Auffinden und die Rettung von Verletzten. Und schließlich sollen die Roboter auch aktiv eingreifen: Das heißt, eine radioaktive Kühlwasserleitung finden und das entsprechende Ventil schließen. Aber nicht alle Teams stellen sich mit ihren Roboter allen drei Aufgaben, manche haben sich auf eine Aufgabe spezialisiert.
Eine anstrengende Angelegenheit
Damit das Ganze unter wirklich realistischen Bedingungen stattfindet, werden in das Reaktorgebäude von Zwentendorf radioaktive Quellen eingebracht. Dafür zuständig ist Rudi Deutsch, Strahlenschutzbeauftragter des österreichischen Heers. „Diese Quellen sind kleine, radioaktive Kügelchen aus Kobalt 60, die in 90 Kilogramm schweren Sicherheitsbehältern transportiert werden“, erläutert Deutsch. Sechs der Quellen werden im Reaktor angebracht, eine auf dem Umgebungsgelände.
Selbstverständlich sind die Roboter mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet, um diese Quellen aufzuspüren. Und sind diese erst mal angebracht, ist das Betreten des Reaktorgebäudes streng verboten. Am Nachmittag aber können die Teams ihre Roboter zunächst testen. Per Räder, Raupen oder auf Wägelchen geht es zu einem Eingang in den Reaktor. In einem Vorraum bauen die Teams ihre Apparaturen für die Fernsteuerung auf, im Inneren sorgen Router und Videokameras für die Kommunikation.
Die Hallen und Gänge im Gebäude sind weitgehend leer und von gelblichen Neonröhren erhellt. Jetzt rollt das Team der TU Darmstadt mit ihrem Roboter heran. Es ist ein Telemax-Hybrid mit vier Kettenantrieben und einem Greifarm. Teamleiter Kevin Daun probiert an seinem Laptop aus, wie die Fernsteuerung funktioniert. „Das ist eine sehr anstrengende Angelegenheit“, erklärt der 27-Jährige, „nach zwei Stunden ist man sehr erschöpft.“ Der Roboter der Darmstädter muss nicht alle Aufgaben erfüllen, bei ihnen geht es um die Vermessung des Geländes und die Standortbestimmung von Verletzten.
Dazu wurden im Inneren des Gebäudes Puppen (in Uniform) installiert, eine davon lehnt in einem Raum im Erdgeschoß an einem Betonsockel, eine weitere findet sich im Flur davor. Und der Telemax legt los, ruckelt und zuckelt mit seinen Ketten durch das Gebäude, umfährt die „Verletzten“ und nimmt schließlich Kurs auf den Reaktorkern. Das ist jetzt ein schwieriger Teil der Übung, denn um in den Kern zu gelangen, muss der Roboter eine Rampe hinunterfahren und zwei mächtige Schleusen passieren. Doch er meistert diese Aufgabe gut, dreht im Reaktorkern mit seinem Gewirr an Kabeln, Leitungen und Aggregaten eine kleine Runde, um dann wieder die Rampe hinaufzurollen. „Wir sind super zufrieden“, so das Fazit von Teamleiter Daun. Auch die anderen Teams drehen ihre Proberunden, bevor es am nächsten Tag dann ernst wird mit der Radioaktivität und die Roboter zeigen müssen, wie sie unter diesen Bedingungen funktionieren. Die Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und auf der Website des Frauenhofer-Instituts einsehbar. Am Darmstädter Öko-Institut hält man diese Bemühungen um Robotertechnik - solange weltweit noch Atomkraftwerke betrieben werden – für „tatsächlich erforderlich, um mit den Hinterlassenschaften schwerer Unfälle umgehen zu können und sich gegebenenfalls für zukünftige Katastrophenfälle besser aufzustellen“, so Nuklearexperte Pistner.
Eine Fortsetzung folgt
Auf der Web-Seite des Frauenhofer-Instituts finden sich auch die abschließenden Bewertungen. So konnte sich das Frauenhofer-Team mit den Robotern „Fenrir“ und „Magni“ den ersten Platz in der Kategorie „Suchen und Retten“ sichern. Wissenschaftler Boris Illing über die Leistung seines Teams: „Das Szenario war auf jeden Fall eine echte Herausforderung und deutlich schwieriger als beim letzten Mal. Aber das macht einen Hackathon aus.
Im Vordergrund steht, dass sich alle Teams austauschen, ihre Lösungen vergleichen und vor Ort noch fieberhaft an ihnen feilen.“ Die Frauenhofer-Techniker waren auch in einer zweiten Disziplin erfolgreich: Exploration. Hier konnte das Team sich den zweiten Platz hinter der Mannschaft von der TU Darmstadt sichern. In der Disziplin „Manipulation“ – also dem Zudrehen von Ventilen – gewann das in Baden-Württemberg beheimatete Unternehmen Telerob.
Hauptorganisator Frank Schneider zog eine positive Bilanz des Robotermarathons und konstatierte „deutlich bessere Leistungen“ als beim ersten Hackathron in Zwentendorf 2017. Allerdings würde er sich eine etwas größere internationale Streuung des Teilnehmerfelds wünschen (Von den Teams stammten sieben aus Deutschland oder Österreich.): „Insbesondere wäre die Teilnahme von weiteren professionellen Teams aus dem kerntechnischen Bereich sicher spannend und aufschlussreich gewesen.“ Angesichts des großen, bereits akuten Unterstützungsbedarfs durch Roboter im nuklearen Anwendungsfeld, in Katastrophengebieten wie Tschernobyl und Fukushima oder auch bei der Stilllegung alter kerntechnischer Anlagen, soll der Robotermarathon 2021 fortgeführt werden.