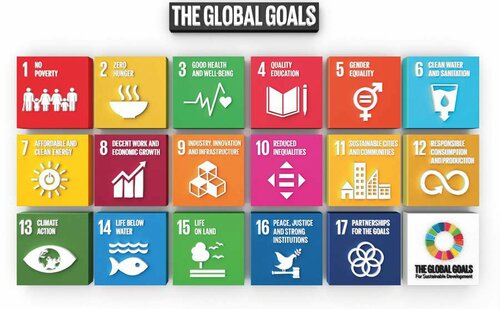Das Bauwesen ist in Deutschland mit einem Beitrag zur Bruttowertschöpfung von aktuell ca. 10 % nominell von vergleichsweise geringerer Bedeutung. Damit soll dessen Beitrag als Konjunkturmotor gerade in Krisenzeiten keinesfalls negiert werden. Schließlich hat die Immobilienwirtschaft im Jahr 2019 mehr als 600 Mrd. € an Bruttowertschöpfung erwirtschaftet [1]. Deutlich höhere und überproportionale Beiträge liefert das Bauwesen hinsichtlich des CO2-Ausstoßes und des Abfallaufkommens. Das hat den Bauschaffenden und der Mitwelt die Bedeutung der Bauwirtschaft für die Nachhaltigkeit, insbesondere in ökologischer Hinsicht, klar vor Augen geführt.
Die Corona-bedingte Situation hat auf der Soll-Seite exorbitante volkswirtschaftliche Anstrengungen und Aufwendungen ausgelöst sowie dramatische Einzelschicksale verursacht. Auf der Haben-Seite werden allerdings Entwicklungen beschleunigt, die unabdingbar waren und sich nun keiner langen Diskussions- und Testphase mit weiterer Ressourcenverschwendung unterziehen müssen. Es geht um Digitalisierung und insbesondere um Nachhaltigkeit im Bau- und Immobiliensektor, die von den Autoren thematisiert werden.
Nachhaltigkeit spielt hier zwar schon länger eine Rolle, doch haben der Green Deal [2] und der Sustainable-Finance-Aktionsplan der EU [3] – möglicherweise auch die Friday-for-Future-Bewegung – als Katalysator gewirkt. Gerade das Thema Klimawandel, durch die traurigen Ereignisse im Juli dieses Jahres mit besonderer medialer Aufmerksamkeit ausgestattet, hat sich im Immobilien-Trendbarometer hinsichtlich der Megatrends vom letzten Platz auf die dritte Position katapultiert [4]. So beeinflussen die sogenannten ESG-Kriterien „Environment“ (Umwelt- und Klimaschutz), „Social“ (gesellschaftliche Verantwortung) und „Governance“ (ethisch moralische Unternehmensführung) nicht nur die Finanz-, sondern zunehmend auch die Immobilienwirtschaft. Es geht um mehr Nachhaltigkeit auf Unternehmens- und Projektebene.
Wertstabilität durch Zertifizierung
Als Bewertungsmaßstab für die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien dienen bekanntermaßen Zertifikate, u. a. von DGNB, Leed und Breeam. Diese erfreuen sich insbesondere im Segment der Büronutzung stetig steigender Beliebtheit. Mittlerweile werden sie als Synonym für Wertstabilität betrachtet. Beispielhaft sei hier der Berliner Markt genannt, bei dem aktuell mehr als die Hälfte aller Neubaufertigstellungen zertifiziert ist [5]. Im Jahr 2019 wurde bereits ein Drittel des Umsatzes institutioneller Investoren in Green Buildings angelegt [6]. Das ist viel, aber noch nicht genug!
Nach dem Abklingen der Pandemie scheint ein allgemeiner, prozessualer Neustart auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft unvermeidlich. Ziel muss es sein, ressourcen- und CO2-intensive Baustoffe klimaverträglicher herzustellen und das Bauen grundsätzlich bezogen auf den gesamten Lebenszyklus, von der Planung bis zum Rückbau, zu betrachten. Im gleichen Zug müssen die Prozesse ökologisch optimiert und insbesondere kreislauffähig gestaltet werden. Darüber hinaus gilt es, wie wir gerade lernen, Abläufe, Strukturen und Gebäude krisenfester, u. a. pandemiere-silienter auszubilden. Diese Aspekte bedingen einander und können nur als Teil des Ganzen betrachtet werden.
Transformation der Wirtschaft durch Forschergeist
Die Gelegenheit, diesen Neustart mit einer ökologischen Neuausrichtung, mit Reformen im Baurecht und der Verwaltung sowie mit einer weitreichenden Datenerfassung, der Verdeutlichung der Bedeutung des Bestands sowie weiteren Aspekten der Digitalisierung und Nachhaltigkeit klug zu verbinden, sollte nicht versäumt werden. Letztendlich geht es um die Transformation der Wirtschaft in eine Circular Economy. Hierzu brauchen wir allerdings weder Verbote noch Verzicht, sondern Unternehmer- und Forschergeist, Innovation, Kooperation und baukulturell wertige Maßnahmen. Die Ressourcenstrategie der Gesetzgeber muss auf Minimierung, Effektivität und Zirkularität sowie insbesondere auf Effizienz setzen. Das findet sich wieder im Life Cycle Engineering. Dabei gilt es sicherzustellen, dass Bauprodukte über eine längere Lebensdauer verfügen. Sie sollten wiederverwendet, aufbereitet, repariert und recycelt werden können sowie einen größtmöglichen Anteil recycelter und gefahrstofffreier Materialien enthalten. Darüber hinaus geht es um die Umwandlung von Baustoffen in hochwertige Sekundärressourcen. Die Entstehung von Abfall ist ganz zu vermeiden. Eine wesentliche Grundlage ist die Verfügbarkeit von Informationen zur stofflichen Zusammensetzung, Herstellungsweise und Lebensdauer sowie zur Reparatur- und Recyclingfähigkeit von Bauprodukten. Hilfreich sind dabei serielles und modulares Bauen, mit optimierten Schnittstellen zwischen den Komponenten. Die Circular Economy kann zudem helfen, die Autarkie bei kritischen Materialien und Produkten zu erhöhen.
Alle Ambitionen müssen aber unbedingt die klein- und mittelständische Struktur der Bauwirtschaft und deren technische Ausstattung berücksichtigen sowie sich am Maßstab der Praktikabilität und Anwendungsfreundlichkeit messen lassen.
Ein weiterer Aspekt ist der Nutzungsflächenbedarf [7]. Heute kann noch nicht endgültig abgesehen werden, wie sich dieser als Folge der Pandemie verändern wird. Es ist unklar, ob perspektivisch weniger Bürofläche benötigt wird, da das Homeoffice diese Reduktion unterstützt, oder ob mit Blick auf Abstandsregeln und weitere technische Ausstattungen Flächen und Kubaturen von Bürogebäuden vergrößert werden müssen. In einer Reihe von Studien wurde versucht, die qualitativen und quantitativen Auswirkungen unterschiedlicher Einflussgrößen zu prognostizieren. Folgt man – exemplarisch – den Jones-Lang-LaSalle-Szenarien [8], so führen die o. g. Effekte im einen Szenario langfristig zu einer deutlichen Reduktion (– 23 %) der bisherigen Büroflächen im Büromarkt, während es in einem anderen Szenario unter dem Strich zu einem erhöhten Bedarf an Büroflächen (+ 14 %) kommt. Das Remote Working, insbesondere Home-Office, wird künftig in jedem Fall ein fester Bestandteil der Bürokultur sein. Andererseits wird das Büro als Ort der persönlichen Begegnung seine große Bedeutung behalten.
Bauliche Standards werden dann u. a. Möglichkeiten für Videokonferenzen und extrem leistungsfähige Netzwerkverbindungen, optimierte Lüftungssysteme und den reduzierten Umfang der technischen Ausstattung sowie weniger Arbeitsplätze pro Gebäude, mehr Zellenbüros und geringere Arbeitsplatzdichte in Großraumbüros sein. Gleichzeitig bleibt die Aufgabe, die Arbeitsplatzqualität im Home-Office sicherzustellen. Das Büro konkurriert zukünftig mit dem Home-Office, muss Berührungspunkt für persönliche Kontakte und Verbindungen werden und schlicht cooler sein. Gewünscht werden hellere Räume, Ruhezonen und individuelle Klimatisierung sowie Infrastrukturen, die auf Interaktion und Kommunikation ausgerichtet sind. Gebaute Beispiele finden wir u. a. bei den amerikanischen Konzernen Google oder Apple. Letztendlich werden sich die Assetklassen Wohnen und Arbeiten immer weiter annähern und verzahnen.
Festzustellen bleibt, dass die Corona-Pandemie einen maßgeblichen Wandel auslöst und die neuen Anforderungen an Wohn- und Büroflächen nicht „höher, schneller und weiter“ lauten, sondern „flexibler bzw. wandlungsfähiger“ [9] sowie „digitaler, wertiger und nachhaltiger“. Das Büro der Zukunft muss bieten, was das Home-Office nicht bieten kann: Information, Interesse, Identifikation und Initiative einerseits sowie Kommunikation, Kooperation und Konzentration andererseits, aber insbesondere auch Resilienz gegenüber neuen Herausforderungen. So generieren die Pandemie und der Green Deal der EU bis 2050 den wohl größten Kapitalbedarf im Gebäudesektor.
Neubau und Bestand
Nachhaltigkeit auf die energetische Effizienz in der Betriebsphase und dann auch noch auf Neubauten zu beschränken, greift deutlich zu kurz. Ein derartig enger Fokus führt zudem häufig weg von schlanken, preiswerten und wartungsarmen Komponenten hin zu High-End-Produkten, die in der Herstellung i. d. R. hohe CO2-Emissionen und bzgl. Kreislauffähigkeit meist Schwierigkeiten mit sich bringen. Der Ressourcenverbrauch darf nicht verschoben, sondern muss insgesamt reduziert werden. In dieser Hinsicht geht auch das seit November 2020 gültige Gebäudeenergiegesetz[10] noch nicht weit genug. Zum Glück gibt es daneben weitreichendere Ansätze, wie beispielsweise Nachhaltigkeitszertifikate (DGNB, Leed …) und das Cradle-to-Cradle-System. Zukunftsweisend sind neue Geschäftsmodelle, bei denen Hersteller ihre Produkte am Ende der technischen Lebensdauer oder wirtschaftlichen Nutzungsdauer zurücknehmen sowie grandiose Start-ups im Bereich der logistischen Prozessoptimierung oder auch der Datenaufbereitung und -auswertung.
Trotz zahlreicher Veröffentlichungen und diverser Nachweisführungen wird die Bedeutung des Gebäudebestands immer noch zu geringgeschätzt. Wir benötigen eine Vervierfachung der aktuellen Sanierungsrate von 1 %, um CO2-Neutralität bis 2035 zu erreichen [11]. Das ist jedoch für die deutsche Bauindustrie mit den heutigen Methoden und Prozessen kapazitativ nicht zu stemmen. So bedarf es kurzfristig der Pareto-Analyse und einer Priorisierung. Als einfaches Kriterium bietet sich der aktuelle energetische Zustand von Gebäuden an. Schließlich wurden fast zwei Drittel des Gebäudebestands noch vor der 1. Wärmeschutzverordnung (WSchVo) gebaut [12]. Bei der Priorisierung sind selbstverständlich bereits durchgeführte energetische Ertüchtigungen an Gebäuden zu berücksichtigen. Eine alternative Kategorie bilden die 1,2 Millionen Wohngebäude, die bis 2020 entstandenen sind. Das bedeutet, dass das Bauen im Bestand in der Analyse und staatlichen Förderung differenzierter betrachtet werden sollte. Dabei spielen sicherlich auch soziologische Befindlichkeiten der Eigentümer und soziale Aspekte auf Seiten der Nutzer eine bedeutende Rolle.
Die Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ist meist mit hohen Kosten verbunden. Staatliche Förderungen für energetische Maßnahmen und steuerliche Abschreibungen sind ein Weg, um finanzierbare Teilsanierungen zu ermöglichen, die einen höheren Beitrag leisten als das Neubausegment. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die ausschließliche Orientierung am Energiebedarf zielführend ist, wenn man eigentlich das Ziel einer Transformation hin zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft und Gesellschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts als Ziel verfolgt. Besser wäre als Richtschnur für ein zukunftsfähiges Konzept aus Sicht der Autoren die unmittelbare Ausrichtung am CO2- Ausstoß, nicht zuletzt hinsichtlich Transparenz und Praktikabilität.
Das Bundesumweltamt publizierte bereits 2013 eine Studie [13], laut der das Ziel einer weitgehenden Treibhausgasneutralität bis 2050 technisch möglich ist. Fünf Jahre später stellte die DGNB mit dem „Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte“ [14] den bisher wohl ganzheitlichsten Lösungsvorschlag für die Dekarbonisierung des Gebäudebestands vor. Es geht dabei um einen gebäudeindividuellen Klimaschutzfahrplan. Hierbei kommt die Methode der Ökobilanzierung zum Einsatz. Je nachdem, welcher Bilanzierungsrahmen gewählt wird, kann ein Gebäude oder Standort auf Grundlage des Rahmenwerks den Status „klimaneutral im laufenden Betrieb“ oder „klimaneutral über den Lebenszyklus“ erlangen.
Die Renovierung großer Teile des Gebäudebestands ist jedoch ein gewaltiges Unterfangen. In [15] wird ein gesellschaftlich kostenoptimaler Weg vorgestellt, über den es möglich wäre, dieses Ziel zu erreichen, ohne den Wohlstand zu beeinträchtigen. Demnach müssten jährlich zusätzliche 180 Milliarden Euro investiert werden. Der grüne Umbau der europäischen Wirtschaft könnte unter dem Strich fünf Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Drei Viertel der Maßnahmen, die wir bis 2030 umsetzen müssen, wären mit heute marktreifen Technologien machbar [15]. Ob diese Überlegungen vor dem Hintergrund der finanziellen Covid- und Hochwasser-Lasten noch innerhalb des geplanten Zeitraums umsetzbar sind, erscheint den Autoren fragwürdig.
Nachhaltigkeit in der Prozess- und Handlungsebene
Ökologische Qualität: Die ökologische Qualität zielt selbsterklärend ab auf einen vergleichsweise wenig belastenden Beitrag des geplanten Bauprojekts zum Ressourcenverbrauch und zur Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus. Maßgeblich sind somit Herstellung und Rückbau am Ende des Lebenszyklus und insbesondere der Betrieb des Objekts während der Nutzungsdauer. Einen sehr positiven Effekt hat aber auch die Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden und ihrer Komponenten. Man bedient sich hierfür der Prinzipien Reparatur (Repair), Aufbereitung (Remanufacturing) und/oder Wiederverwendung (Reuse). Gemäß [9] bedeutet reparieren, eine Komponente wieder in den früheren intakten, gebrauchsfähigen Zustand zu bringen. Beim Austauschen von Komponenten unterscheidet man Ersetzen, Aktualisieren bzw. Updaten sowie Aufwerten bzw. Upgraden [9].
Soziale Qualität: Die soziale Qualität hat a priori das Wohlbefinden der Nutzer zum Ziel. Es geht dabei neben dem Raumkomfort auch um das Gefühl der Sicherheit. Dem wird insbesondere durch Ingenieur-Know-how und technische Applikationen, u. a. für visuelle, akustische und thermische Standards, Rechnung getragen. Ein weiterer Ansatz liegt in der interkulturellen und -disziplinären Begegnung und Kommunikation der Nutzer und der weiteren Mitwelt.
Ökonomische Qualität: Die ökonomische Qualität hingegen ist ebenso innovativ, wie sie häufig missverstanden wird. Der Wirtschaftlichkeitsansatz ist nicht einer Kostenbetrachtung im üblichen Sinn gewidmet. Die ökonomische Qualität huldigt der Erkenntnis, dass nur das dauerhaft und damit nachhaltig sein kann, was „sich rechnet“. Die Projekte bedürfen einer besonderen Marktfähigkeit, damit ressourcenvernichtende Leerstände oder Rückbauten vor Ende der technisch möglichen Lebensdauer ausgeschlossen werden können. In diesen Kontext fallen die Themen Umnutzungsfähigkeit und Fungibilität durch bauliche Flexibilität und Wandlungsfähigkeit [9]. Die Begrifflichkeiten sind in jedem Fall kritisch zu hinterfragen, da zunächst möglicherweise zusätzliche Ressourcen gebunden werden. Korrigierend wirkt hier eine intensivierte Bedarfsplanung.
Die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit von Gebäuden gilt uneingeschränkt als Kriterium der ökonomischen Qualität in Zertifizierungssystemen zur Nachhaltigkeit des Bauens, sowohl des Bundes [16], als auch der DGNB [17]. Im Sinne der Bauschaffenden impliziert nachhaltige Planung aktuell, Gebäude so flexibel wie möglich und mit größtmöglicher Wandlungsfähigkeit zu konzipieren. Die wissenschaftliche Meinung attestiert diesen Gebäuden eine hohe Akzeptanz der späteren Nutzer, eine lange Nutzungsdauer, niedrige Lebenszykluskosten und schließlich eine reduzierte Inanspruchnahme von Ressourcen.
Wo liegt der Grenznutzen?
Bezüglich der Forderungen hinsichtlich der Flexibilität und Wandlungsfähigkeit gibt es allerdings einen Grenznutzen, der nach der Zielerreichung umschlägt und die Nachhaltigkeitsaspekte kontraproduktiv bedient. So wird oberhalb des Grenznutzens die Bedarfsplanung [18] des Nutzers nur suboptimal umgesetzt. Der Nutzer erhält ein Gebäude, das seine Wünsche und Anforderungen bestenfalls nur fast vollständig erfüllt, da die Decken teilweise zu hoch sind, die leichten Trennwände einen schlechten Schallschutz aufweisen und nicht zum Lastabtrag herangezogen werden können und die technische Gebäudeausrüstung zu träge reagiert, da sie ein größeres Gebäudevolumen bedienen muss. Weiterhin sind dieser Flexibilität und Wandlungsfähigkeit aber auch Ressourcen geschuldet, die zu höheren Investitions- und Lebenszykluskosten führen und die gebotene Ressourcenschonung durch zusätzlichen Energie- und Baustoffbedarf negieren.
Gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass das bauliche Anforderungsprofil in 20 oder 30 Jahren innerhalb einer Umnutzung prognostiziert werden kann. Das ist möglicherweise ein dramatischer Trugschluss, da bezüglich der Arbeitsplatzgestaltung, der Herausforderungen des demographischen Wandels, des Städtebaus, der Infrastruktur und neuer Mobilitätskonzepte sowie vor dem Hintergrund der Transformation in eine Kreislaufwirtschaft aktuell Entwicklungsschübe in Quantensprüngen vorliegen. Das Gleiche gilt bezüglich klima- und umweltfreundlicher Bauweisen, neuer Materialien und Technologien sowie für Fortschritte in der technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere im Schwachstromsegment. Somit ist in vielen Fällen zu befürchten, dass sich die Prognosen nicht verifizieren und am späteren Bedarf (und an den späteren Möglichkeiten) „vorbeigebaut“ wird. Die aktuelle Pandemie ist ein sehr gutes Beispiel für Imponderabilien innerhalb von vermutet belastbaren Prognosen.
Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Die beiden wohl wichtigsten Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit, sind lt. [19] die wachsende Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit und die enormen Fortschritte in den Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die Bau- und Immobilienbranche hat beide Aspekte nur halbherzig verfolgt. So ist es eine der wichtigsten Aufgabe der kommenden Jahre, die neuen technologischen Möglichkeiten für eine global nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen. Ziele sind einerseits eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, andererseits Klimaneutralität. Besondere Beachtung verdient dabei die im Vergleich zu Konsumgütern lange Nutzungsdauer von Gebäuden.
Und: Nachhaltige Entwicklung kann nur digital gelingen! Digitalisierung ist Synonym für eine Vielzahl von Basis- und Querschnittstechnologien und wird mittlerweile bereits als separater Zweig der Ökonomie betrachtet [20]. Die Digitalökonomie hat sich insbesondere in der Disruption etabliert. Viele Startups nutzen, dass sich die Markteintrittsbarrieren senken, der Wettbewerbsdruck erhöht und insbesondere die Grenzkosten infinitesimal gering sind. Das ermöglicht hohe Grenzerträge und übt große Finanzierungsanreize für neue Firmen aus. Die anderen Marktteilnehmer müssen diesem Wandlungsdruck initiativ entgegenwirken, um keine Marktanteile zu verlieren. Das führt zu investorengesteuerten Startups, den sogenannten Disruptoren, mit schlanken und effizienten Strukturen sowie hochgradig digitalisierten Betriebsprozessen, die einen einzigartigen Mehrwert generieren. Kernelement ist — sowohl beim Neubau als auch beim Bauen im Bestand — ein zeitgemäßes Datenmanagement. Dabei könnten, in Analogie zur Pandemie, ein Monitoring (statt „Testen“) und eine Sanierungsquote (statt „Impfquote“) hilfreich sein. Der Gesetzgeber hat das scheinbar erkannt und versucht, mit der Einführung von Smart Metern, der CO2- Steuer und der EU-Taxonomie [21] regulativ zu reagieren. U. a. hier setzen die Startups an und strukturieren Datenerfassung, Auswertungsalgorithmen und Bewertungstools. Die DGNB hat mit dem Statement „klimaneutrale Gebäude und Standorte“ [14] Regeln für die CO2-Bilanzierung, die CO2-Berichterstattung und CO2-Management-Methoden aufgezeigt. Grundlage für jegliche Bewertung ist die Digitalisierung. Denn Daten, ausschließlich Daten, müssen erhoben, erfasst und evaluiert werden. Nur so lassen sich Vorgaben überprüfen und insbesondere Vergleiche aufstellen.
In Quantensprüngen zu rentablen Projekten
Die EU schafft aber auch Handlungsspielräume. So ermöglicht die Directive 2014/24/EU [22] den Mitgliedsstaaten, in ihren Vergabeverfahren für Bauleistungen Tools für die digitale Datenmodellierung von Gebäuden einzufordern. Seit Ende 2020 ist der Einsatz von BIM bei der Vergabe zumindest von Infrastrukturprojekten der öffentlichen Hand für die Bieter verbindlich [23]. Mit dem flächendeckenden Einsatz von BIM nähern wir uns fraglos in Quantensprüngen ressourcenschonenden und ökonomisch rentablen Projekten deutlich an. BIM ermöglicht die Datenerfassung bei der Planung und Finanzierung, im Bau und Betrieb und dem deutlich späteren Rückbau. Der digitale Zwilling unterstützt nicht zuletzt den Abgleich mit ausgegebenen Referenzwerten.
Das smarteste Gebäude und die beste Sensorik bleiben Muster ohne Wert, wenn die ermittelten Daten nicht substantiiert in ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement eingebettet werden. So werden mit der EU-Taxonomie seit 2020 [21] Kriterien für klimaverträgliche Investments fixiert, die zwingend einer datenbasierten Grundlage bedürfen. Analoges gilt für Smart Meter. Die Einbindung ins Netz der Energieversorger generiert die Daten für Nutzer, aber eben auch für Netzbetreiber, Energielieferanten und weitere Messstellenbetreiber. Ergo: Das Bauwesen braucht ein gemeinsames Datenmodell. Das Cube in Berlin ist eindrucksvolles Beispiel. Sensorik liefert sowohl Informationen aus der Umwelt als auch dezidierte Nutzungsdaten der Mieter. Ein Resultat sind nutzungsoptimierte Verhältnisse der TGA, die weitestgehende Ressourcenschonung implizieren. Auch hier sind die Startups besonders aktiv. Die Entwicklung bleibt spannend!
Literatur
[1] ZIA (2019): Immobilienwirtschaft 2019, Zentraler Immobilienausschuss e.V., Berlin
[2] EU (2019): Der europäische Grüne Deal, Europäische Union, Brüssel, 11.12.2019, COM (2019) 640
[3] EU (2020): EU-Aktionsplan Sustainable-Finance, Verordnung 2020/852 (Taxonomie-Verordnung)
[4] EY Real Estate (2021): Studie Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt, Pressemitteilung 13.01,2021
[5] Berliner Sparkasse (2021): Marktbericht 01/2021 Nachhaltigkeit, bulwiengesa.de
[6] BNP Paribas (2020): BNP Paribas Real Estate Market Focus 2020, Investmentmarkt Green Buildings
[7] DIN (2016): DIN 277:2016-01 Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau, Beuth Verlag
[8] Stöder C. (2020): Büromärkte nach Corona: Szenarien für die künftige Bedeutung der Büronutzung; Jones Lang LaSalle SE
[9] Heusler W.; Kadija K (2022).: Innovative Fassaden – Bedeutung von Kompatibilität und Interoperabilität; erscheint demnächst in Weller, B.; Tasche, S. [Hrsg.] Glasbau 2022. Berlin: Ernst & Sohn.
[10] BMI (2020): Gebäudeenergiegesetz – GEG – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, BM des Innern, für Bau und Heimat, 13.08.2020
[11] Wuppertaler Institut (2020): CO2-neutral bis 2035, Bericht Oktober 2020
[12] BMWi (2014): Sanierungsbedarf im Gebäudebestand, Ein Beitrag zur Energieeffizienzstrategie Gebäude, BM für Wirtschaft und Energie, 12/2014
[13] Umweltbundesamt (2013): Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050. Verfügbar unter: www.uba.de/publikationen/treibhausgasneutrales-deutschland-im-jahr-2050
[14] Braune, A., Geiselmann, D., Lemaitre, C., Oehler, S. (2018) Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte, DGNB
[15] d‘Aprile, P., et al. (2020): Wie die Europäische Union Netto-Null-Emissionen zu Netto-Null-Kosten erzielen könnte; Bericht McKinsey, 3. Dezember 2020
[16] BMI (2019): Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), Leitfaden Nachhaltiges Bauen, 3. Auflage 2019, BM des Innern, für Bau und Heimat
[17] Zertifizierungssysteme für Gebäude, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), www.dgnb.de
[18] DIN (2016): DIN 18205:2016-11 Bedarfsplanung im Hochbau
[19] WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2019): Unsere gemeinsame digitale Zukunft. Berlin, WBGU.
[20] Digitalökonomie, Digitalwirtschaft, Onpulson-Wirtschaftslexikon, www.onpulson.de/lexikon
[21] EU (2020): EU-Taxonomie-Verordnung: Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen, Juni 2020
[22] EU (2014): Directive 2014/24/EU ; Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rats über die öffentliche Auftragsvergabe, 26.02.2014
[23] BMVI (2015): Stufenplan Digitales Planen und Bauen, BMVI